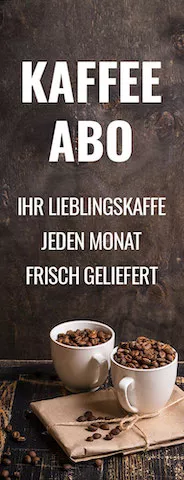Unser Kaffee- & Espresso-Versprechen
Die besten Aromen aus Afrika, Amerika & Asien.
Mit Leidenschaft frisch geröstet aus Bayern.
Weil die Murnauer Kaffeerösterei beste Qualität und Frische garantiert, wird mehrmals pro Woche geröstet. Das Ergebnis dieser hingebungsvollen Arbeit können Sie bei jedem Schluck schmecken: Ihre Geschmacksnerven werden es Ihnen tausendfach danken – und Sie werden unvergessliche Genussmomente haben! Das ist unser Ziel, das ist unser Versprechen – das ist unser Genusskonzept.
Amerika
Amerika
Amerika
Afrika
Amerika
Amerika
Für Ihre Genussmomente: Neue Produkte in unserem Shop
Schnelle Lieferung
klimaneutral mit DHL
Die Zustellung Ihres Paketes erfolgt über unseren Versandpartner DHL GoGreen.
Frischegarantie
für alle unsere Produkte
Täglich frisch geröstet gewährt 100% frischen Kaffeegenuss.
Persönliche Beratung
unter 08847 / 6959 001
Wir beraten Sie in allen Fragen zu Produkten und Bestellungen.
5 € geschenkt* für Ihre Newsletter-Anmeldung
Tauchen Sie ein in die Welt des Kaffees und freuen Sie sich auf exklusive Angebote und tolle Aktionen. Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an und erhalten Sie 5 €-Rabatt* auf Ihren Einkauf.
* Das Angebot gilt nur für Erstanmeldungen; Der Mindestwarenwert beträgt 30 €; Nicht mit anderen Gutscheinen oder Rabattcodes kombinierbar.
Abmeldung jederzeit möglich. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung